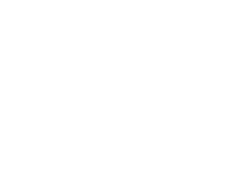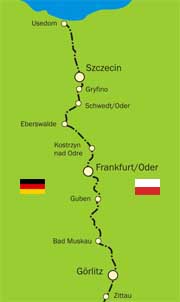|
Die Delegation aus Bersenbrück macht sich wieder auf den Weg, nur Gudrun bleibt noch etwas länger. Die Mutter von Leszek hat das Frühstück vorbereitet und weil sie so viele Geschichten zu erzählen hätte, bin ich auch schon eingeladen. Babcia Edwina - Oma Edwina – wie sie Gudrun nennt, wohnt im neueren Teil der Stadt, nördlich der Eisenbahnstrecke. „Die Stadt hat in den 70er Jahren einen Boom erlebt mit dem Bau des benachbarten Elektrizitätswerkes“, erklärt mir Leszek, wobei er hinzufügt, dass die Gemeinde gegenwärtig ca. 21.000 Einwohner zählt. Edwina erwartet uns bereits. Doch wie eine Großmutter sieht sie gar nicht aus, bis auf die weißen Haare! Bereits wenig später gibt sie mir eine sehr spezielle Lektion in Geographie. Aus dem Gedächtnis zählt sie mir die 11 Orte auf, in denen sie einmal lebte und schildert die Zeit des Krieges, als ihre Familie zwischen den Deutschen und den Russen hin- und hergeworfen wurde. Mehrmals musste die Familie aufbrechen, ohne etwas mitnhmen zu können, um der Front zu weichen. Edwina erinnert sich an alles, ohne Bitterkeit und Rache. Gudrun ist sehr bewegt. Ich meinerseits bemerke die Ähnlichkeiten in den Geschichten der Vertriebenen von deutscher Seite und von polnischer Seite. Edwina bringt selbstgebackenen Kuchen und wir sprechen von leichteren Dingen wie der polnischen Tradition, die Namenstage zu feiern. In Polen wird der Namenstag ähnlich gefeiert wie hierzulande der Geburtstag. „Sehr praktisch für diejenigen, die ihr zunehmendes Alter nicht mehr feiern wollen“, scherzt Leszek. „Bei uns sind es die Katholiken, die ihren Namenstag feiern“, sagt Gudrun. Edwina serviert derweil den Pfirsichlikör, ein Geschenk anlässlich ihres Namenstages. Es ist früh am Morgen, als ich im Rathaus von Gryfino an die Tür von Leszek Ludwiniak klopfe. Er stellt mir seine deutsche Kollegin vor, Gudrun Henrici, der Verantwortlichen für die Städtepartnerschaft zwischen Gryfino und Bersenbrück. Die beiden hören aufmerksam zu, was ich über den Veloblog zu erzählen habe und zeigen sich begeistert. Doch leider bleibt uns nur die Zeit, einen Kaffee zu trinken und währenddessen über die Stadt und ihre Bewohner zu sprechen, denn beide haben viel zu tun. Und doch: gedankt sei dem polnischen Improvisationstalent, denn Leszek schlägt mit vor, mich mit dem Auto nach Stettin mitzunehmen, wohin er sowieso fahren müsse, was mir wiederum erlaubt, meinen Aufenthalt in Gryfino zu verlängern. Und hoppla ! Schon finde ich mich in einer Abschlussversammlung der Partnerstädte wieder, bei der es um ein gemeinsames Austauschprojekt geht, insbesondere aber um Material für Behinderte, das die Deutschen mitgebracht haben. „Das nächste Mal müssen wir uns aber so arrangieren, dass ihr nicht mit leerer Luft im LKW nach Hause fahrt“, sagt der Bürgermeister, während er allen ein Glas Cognac anbietet… bis auf den „Chauffeur“, wie er auf polnisch sagt. Leszek meistert bravourös die Übersetzung, denn nun wird von ernsten Dingen gesprochen. Von dem Industriegebiet von einigen hundert Hektar Größe zwischen Gryfino und Stettin, von den Anlegestellen, die es entlang des östlichen Oderarmes zu renovieren gilt und von der Integration der behinderten Kindern in die Gesellschaft. „Früher waren es die Regierungen, die solche Austausche organisiert haben. Heute sind es die Menschen selbst“, sagt der Bürgermeister. „Und ich freue mich, dass die deutsch-polnischen Beziehungen schon fast so gut geworden sind wie die deutsch-französischen.“ Ein Deutscher der Delegation der Partnerstadt fügt hinzu: „Die Regierungen kommen und gehen, aber die zwischenmenschlichen Beziehungen, die bleiben bestehen.“ Es ist ein schöner Moment, um sich gut zu unterhalten. Gudruns und Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich in einem Wohnwagen übernachtet. Doch nicht deswegen gefällt mir der Campingplatz von Mescherin so gut, sondern wegen seiner Atmosphäre und seiner schönen Umgebung. Der Campingplatz von Mescherin existiert bereits seit mehr als 50 Jahren. „Der hat die Wiedervereinigung überlebt“, witzelt einer der Verantwortlichen. Doch nur knapp, denn nach seiner Privatisierung in den 90er Jahren wäre der Campingplatz beinahe auf der Strecke geblieben. „Selbst wenn man genug Gäste hat, kann man nicht davon leben, der ist einfach zu klein.“ Aber das Schiff einfach sinken lassen? Nein! Der Campingplatz wurde von einem Verein der Gemeinde übernommen, dem Dorfverein am Oderstrom e.V. „Österreicher auf der Durchreise bei uns haben uns einmal gesagt, dass wir der einzige Campingplatz seien, der direkt am Oder-Neisse-Radwanderweg liegt“, wiederholt stolz der Bürgermeister der Gemeinde. Und es ist alles da, was man braucht. Zelte und Wohnwagen gibt es für ganz Spontane gegen eine Leihgebühr, und für Frühaufsteher bietet der Platz einen herrlichen Blick über die Ufer und Auen der Oder. Und schließlich ist auch noch der Bürgermeister da, der Euch gern dabei hilft, ein kleines Treffen bei seinem polnischen Amtskollegen in Gryfino zu organisieren. Während er mir die moderne Anlegestelle von Mescherin mit den leeren deutschen Zollhäuschen zeigt, erzählt mir Herr Menanteau von den Butterfahrten, jenen Bootsfahrten, zu denen Deutsche wie Polen in Massen strömten, um zollfrei Produkte zu kaufen. „Um die tausend Polen kamen zu Fuß über die Oderbrücke (1, 2), um auf der deutschen Seite an Bord der Schiffe zu gehen. Und es kamen auch etwa 20 deutsche Busse, die weitere Passagiere brachten“, erklärt Herr Menanteau. Schwer vorstellbar bei einer 500-Seelen-Gemeinde wie Mescherin. Doch noch schwieriger zu verstehen ist für mich das für die Gewässer der Oder damals gültige Zollsystem. Die auf der deutschen Seite registrierten Schiffe nahmen ihre Passagiere auf, fuhren dann zur polnischen Seite und ließen sich dort registrieren. De facto verließen sie somit Deutschland. Die Produkte an Bord konnten nun zollfrei verkauft werden. Daraufhin fuhren die Schiffe eine Schleife und kehrten zur deutschen Seite zurück, wo sie ihre gesättigten Passagiere entluden. Etwa im Stundenrhythmus legten die Schiffe an und tauschten ihre Kundschaft aus. „Für die Gemeinde war das Geschäft mit den Butterfahrten sehr rentabel. Zwei Reedereibetriebe mieteten unsere Anlegestellen.“ Doch seit Polen im Mai 2004 der EU beigetreten ist, leeren sich die Kassen der Gemeinde: die Butterfahrten gibt es nicht mehr und die Anlegestellen von Mescherin sind günstig zu mieten… Und wieder reden wir vom Geld: Mit dem Beitritt Polens zur EU wurde auch die Oderbrücke, die Mescherin mit Gryfino auf der polnischen Seite verbindet, für den Kraftwagenverkehr geöffnet. Die Kontrollen nahmen ab, man konnte es sich ja erlauben, erklärt mir der Bürgermeister von Mescherin. Doch plötzlich stellte auch die Wäscherei auf der polnischen Seite, welche den Großteil der Hotels auf der deutschen Seite beliefert, ihre Fähre praktisch ein. „Die Wäscherei hatte eine Fähre eingerichtet, um die Staus bei Schwedt zu umgehen. An unserer Anlegestelle wurde die Wäsche dann entladen und auf firmeneigene LKW verladen.“ Doch seit die Brücke für den LKW-Verkehr geöffnet ist, hat die Wäscherei ihren Fährbetrieb natürlich eingestellt. Doch glaubt jetzt nur nicht, Herr Menanteau wolle Polen nicht in der EU haben, nein: es ist vielmehr die finanzielle Situation seiner Gemeinde, der er als Bürgermeister seit mehr als sechs Jahren vorsteht, die ihm Sorgen bereitet. „Man muss jetzt umdenken und gemeinsam europäische Projekte entwickeln, um Gelder zu bekommen, Deutsche und Polen zusammen.“ Den Bürgermeister von Mescherin, Herrn Menanteau, traf ich zum ersten Mal im “Gemeinschaftshaus”, dem heutigen deutsch-polnischen Begegnungszentrum. Diese Räume haben eine lange Geschichte. Vor und nach dem Krieg beherbergte das Haus eine Schule, später, zu DDR-Zeiten, einen “Konsum”, sprich: die dorfeigene Kaufhalle, bis das Gebäude nach der Wende schließlich renoviert wurde und nun das Begegnungszentrum des Dorfes ist. Doch es ist vielmehr die Geschichte seiner Familie, die mir Herr Menanteau erzählt. Die Geschichte einer hugenottischen Familie, die aufgrund ihres Glaubens durch das Edikt von Nantes (1635) aus Frankreich vertrieben wurde. Brandenburg nahm die vertriebenen Hugenotten auf, um die Region zu bevölkern. Die aus Tours stammende Familie Menanteau siedelte sich im 17. Jh. in Vierraden an, wo die Hugenotten maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Tabakindustrie hatten. Herr Menanteau selbst war Landwirt, bevor er in Rente ging. Er erzählt mir von “volkseigenen Gütern” und “Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften”, den sogenannten LPG. Erstere waren staatseigene Güter der DDR, die letztgenannten landwirtschaftliche Kooperativen. “Ich habe mich geweigert, in einer LPG zu arbeiten, weil jeder was zu sagen hatte, aber nie eine Entscheidung getroffen wurde”, erzählt er mir. “Da bin ich lieber in eines der „Volksgüter“ gegangen. Durch die Organisation und die Hierarchie ist es letztendlich eine Person, die entscheidet. Das ist klarer.” Landwirtschaft damals und Landwirtschaft heute: im Alter von 70 Jahren lebt Herr Menanteau mit seiner Zeit. “Hier bei uns lebt man in erster Linie von der Landwirtschaft. Und es wird immer schwieriger. Allein schon mit den Produkten aus Holland und Spanien.» Herr Menanteau fürchtet den Beitritt Polens zum Schengener Raum: “Die Produkte werden billiger sein, da die Löhne in Polen niedriger sind als bei uns. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es für unsere Landwirte noch schwieriger wird, denn den technischen Fortschritt Deutschlands werden die Polen rasch aufgeholt haben.” Er vertraut mir an, dass er bewusst deutsche Produkte kauft, um die deutschen Produzenten zu unterstützen. “Nur tanken gehe ich in Polen, in Gryfino, weil das näher liegt. Fünf Kilometer anstelle von 30 !” Gryfino, das ist die polnische Stadt auf der anderen Seite der Oder. Früher waren die Gemeinden miteinander verbunden durch eine kleine Holzbrücke, später durch eine Metallbrücke, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Die Brücke, die dann errichtet wurde, war zunächst allein dem Militär vorbehalten. Erst 1990 wurde die Brücke für Fußgänger und Fahrradfahrer geöffnet. Und seit 2004 ist die Fahrt über die Brücke auch mit dem Auto möglich. Seit dem Tag des Eintritts Polens in die EU. Der Eintritt Polens in die EU, nein, dagegen hat Herr Menanteau nichts. Doch als Bürgermeister der Gemeinde Mescherin seit über sechs Jahren sieht er allein die negativen finanziellen Folgen. “Eine Geschichte, die sich mit einem Minus davor schreibt!” Zwischen Gartz und Mescherin, nur ca. 6km entlang des westlichen Oderarmes. Eine wunderbare Fahrt durch einen Wald mit Namen „Schrey“. Es ist angenehm schattig und man findet schnell einen Begleiter. Und dabei spreche ich nicht von den Mücken, die einen ein wenig zu herzlich empfangen, sondern von den Bewohnern Mescherins, die auf ihrem Weg zum Einkauf in Gartz sind. Ein Stück weiter erfahre ich, dass die Natur in gewisser Weise vom Krieg profitiert hat, unter dem sie zuvor sehr zu leiden hatte. Die Tatsache, dass es hier viele sehr alte Bäume gibt, erklärt sich aus der Weigerung der Schiffsfabriken und anderer Holzverwerter, dieser Stämme zu verarbeiten, die geradezu gepanzert sind durch die Vielzahl von Granatsplittern und Gewehrkugeln in ihren Stämmen. Es ist die Fassade der Schule, die meine Aufmerksamkeit weckt: «Friedensschule» ist dort in großen Lettern zu lesen. Davor sitzt ein fleißiger Schüler in sein Heft vertieft, das zugleich die Farben Deutschlands und Polens trägt. Als ich mich erkundige, erfahre ich, dass es bei den Diskussionen um die Umbenennung der Schule geht, die noch immer ihren Namen aus DDR-Zeiten trägt. Die Entscheidung sollte bis zum Schulbeginn gefallen sein, doch bis heute, eine Woche vor dem Termin, wurde keine Änderung angekündigt. Eine andere Geschichte ist die der Dynamik in der deutsch-polnischen Kooperation. Es geht um die Gesamtschule, eine Einrichtung, welche sowohl Schüler der Grund- und der Oberschule vereint und darüber hinaus zwischen 1993 und 2006 polnische Schüler der benachbarten Gemeinden aufnahm, um sie auf das deutsche Abitur vorzubereiten. Doch inzwischen fehlen Gartz die Kinder, um die Klassen der Sekundarstufe auszulasten, das Projekt ist beendet. Vorläufig?
Nein, es ist kein Spezialflug der Lufthansa : hier handelt es sich um echte Kraniche die Ende September, Anfang Oktober in dem grenzüberschreitenden Schutzgebiet «Internationalpark Unteres Odertal» Station machen. Wie mir Herr Arndt vom Förderverein für die Region Gartz (Oder) e.V. erklärt, kommen « durchschnittlich mehr als 15.000 Kraniche jedes Jahr in die Region. » Die schönen Sommertage verbringen die Zugvögel in den skandinavischen Ländern und machen sich dann auf den Weg in den Süden Frankreichs oder Spaniens, wo sie überwintern. Die Kraniche schlafen auf der polnischen Seite, zwischen den beiden Oderarmen, dort, wo die Natur noch pur ist. Doch tagsüber fliegen sie auf die deutsche Seite zum Fressen auf die frisch abgeernteten Felder. « Die Vögel kennen keine Grenzen. Und die lokalen Vereine tun ihr Bestes, um gemeinsam die Ornithologen und die Neugierigen zu empfangen, die alljährlich kommen, um dieses Ereignis zu erleben. Die Gemeinden von Gartz auf deutscher Seite, sowie Gryfino und Marwice auf polnischer Seite erwarten alle Interessierten und Vogelfreunde in diesem Jahr zwischen 28. September und 07. Oktober. Vergesst nicht, ein Fernglas einzustecken !
Die Empfehlung des « Ackerbürgermuseums » erhielt ich von Herrn Arndt vom Förderverein für die Region Gartz (Oder) e.V., nachdem er mir ein Buch über die Geschichte und die Aktivitäten in der Gemeinde überreicht hatte. „In erster Linie ist die Region agrarisch geprägt, auch wenn es nach der Wiedervereinigung Deutschlands schwieriger geworden ist – wir haben hier eine Arbeitslosigkeit von fast 25% - dennoch hat die Landwirtschaft in dieser Region weiterhin den größten Stellenwert.“ So erzählt er mir von der Tradition der Erntedankfeste, welche in den Gemeinden der Region mit großen Umzügen, mit geschmückten Pferdewagen und hübschen Fräulein gefeiert werden. Prompt in dem Moment, in dem sich Frau Mielke anschickt, Feierabend zu machen, stehe ich vor dem kleinen Ackerbauermuseum. Ihr Mann erwartet sie bereits vor der Tür, doch dessen ungeachtet nimmt sich Frau Mielke die Zeit, mir eine Museumsführung zu geben. Die Geschichte der Stadt erzählt sie mir anhand eines Holzmodells, wobei sie nicht versäumt, mir unter anderem einen Besuch bei der Mühle der Stadt zu empfehlen: sehr romantisch! Doch leider bleibt mir keine Zeit mehr für die Mühle. Doch das Schöne an Frau Mielkes Erzählungen ist, dass sie ein wenig ihre eigene Geschichte mit jener der Stadt mischt. Als sie von dem « Kanonenschuppen » spricht, erinnert sie sich der Zeit, als hier noch die Kanonen zwischengelagert waren und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Vertriebenen aus dem Osten hier eine erste Zuflucht fanden. Doch sie spricht auch von den Empfängen während der DDR-Zeiten. « Es waren Empfänge für die Landwirte » erzählt sie mir. « Wir trugen unsere sonntägliche Tracht und empfingen die Leute mit Sekt“. Im Museum zeigt sie mir die besagten pommerschen Trachten. Auch als sie mir die Heimatstube zeigt, eingerichtet dank der Spenden der Bewohner, schwingen Frau Mielkes Kindheitserinnerungen mit. In der kleinen Ecke, welche der FDJ gewidmet ist, der Jugendorganisation der ehemaligen DDR, hebt sie die Augenbrauen: „Meine beiden Ältesten waren bei der FDJ. Da gab es wenigstens eine gewisse Struktur, organisierte Aktivitäten und Sport“, sagt sie mir. „Und sie hingen nicht auf der Straße rum.“ Frau Mielke tut es ein bisschen leid um die guten alten Zeiten. „Wir hatten eine Molkerei, einen Einkaufsladen und ein Kino.“ Alles weg. Naja, jetzt haben wir PLUS und Schlecker, das ist was anderes.“ Sie zuckt mit den Axeln. Was ihr am meisten fehlt, und sie ist nicht die einzige, die mir das anvertraut, ist das kleine « Theater des Friedens ». Nach der Wiedervereinigung hatte die Gemeinde jedoch nicht mehr die notwendigen Mittel, eine solche Einrichtung zu finanzieren. Das kleine Theater ist seitdem geschlossen und, trotz der Übernahme durch eine Privatperson, zerfällt es langsam. „Das war unser kleines Kino, die Kinder erhielten dort ihre Zeugnisse und feierten « Jugendweihe », das staatliche Pendant zur Konfirmation zu DDR-Zeiten. Wir haben so viele Erinnerungen daran, es ist tatsächlich ein Blatt der Geschichte, das umgeschlagen wird…“ Anne, meine junge Gastgeberin aus Schwedt, begleitet mich bis auf die Höhe der städtischen Papierfabrik. Einst war diese Fabrik im Bereich des Papierrecyclings die wichtigste Fabrik Europas, wie mir Annes Vater erzählte, der hier arbeitet. Danach wende ich mich nach Gartz an der Oder, ca. 20km weiter nördlich. Unterwegs passiere ich einige kleine Gemeinden wie die von Friedrichsthal, wo der Tabakanbau eine große Rolle spielte. Mehrmals habe ich die Gelegenheit, die riesigen Scheunen zu bewundern, die zum Trocknen der Tabakblätter dienten. In Gartz angekommen, erahne ich angesichts der imposanten Bauwerke den vergangenen Reichtum der Stadt… Wie ich erfahre, war Gartz, das heute 2.000 Einwohner zählt, im Mittelalter eine Hansestadt, ebenso wie Frankfurt (Oder). „Was der Stadt ihren Reichtum sicherte“, erzählt mir Herr Arndt vom Förderverein für die Region Gartz (Oder) e.V., war unter anderem „eine Eisenkette, die quer über die Oder gespannt war. Es musste ein Zoll an die Gemeinde entrichtet werden, woraufhin diese die Kette heben ließ und den Schiffen die Durchfahrt gewährte“. Schwer vorstellbar heutzutage, doch offensichtlich war diese List durchaus rentabel. Bereits im 13.Jh besaß die Stadt einen Stadtmauer-Ring mit steinernen Mauern, Festungsgraben und Palisaden. Reste dieser Stadtmauer sind hier und da noch sichtbar, insbesondere im Norden der Stadt. Natürlich darf das Stettiner Tor an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, welches sich zwischen dem Rathaus und dem kleinen «Ackerbürgermuseum» befindet. |